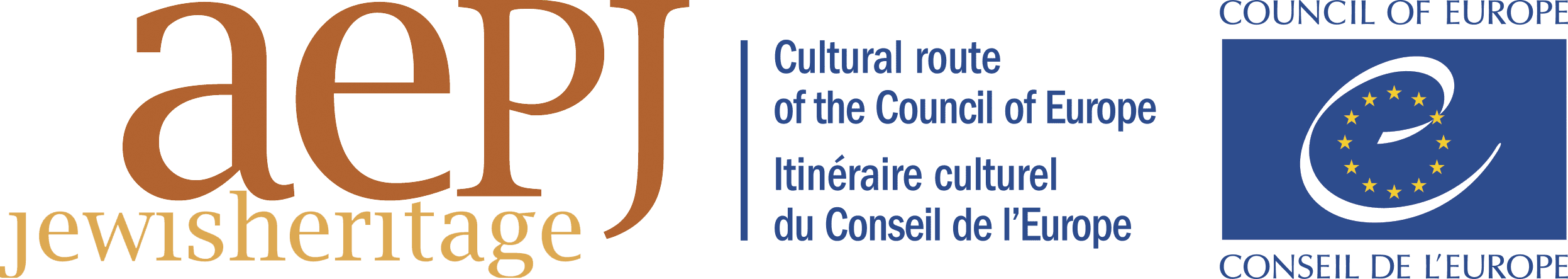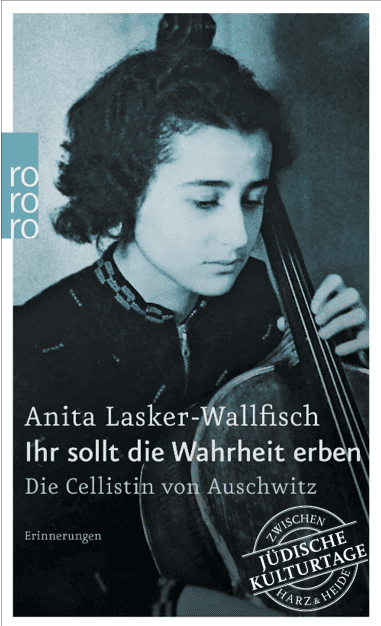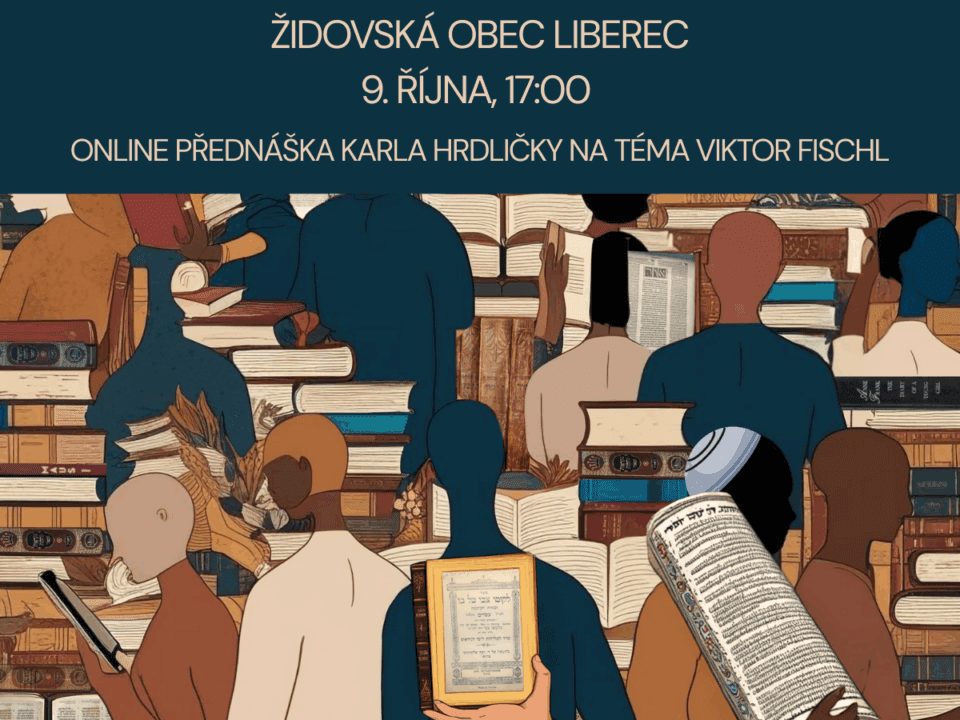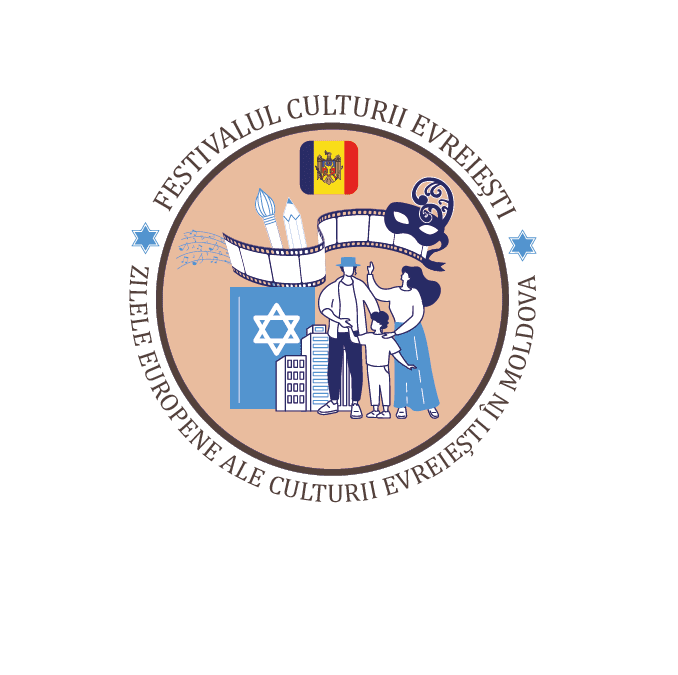Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
En 1958, Félix Chevrier (1884-1962), ancien résistant et directeur de la colonie de Chabannes, nommé Juste parmi les nations en 1999, fait don de ses papiers au Mémorial de la Shoah. Dans ces archives, un document de 170 pages rédigé par le personnel et les enfants de la maison de l'OSE (Œuvre de secours aux enfants) installée à Chabannes : le journal de Chabannes. Ce journal vient d'être inscrit au registre international de la mémoire du monde, avec d'autres dessins d'enfants réalisés pendant la seconde guerre mondiale. Une histoire et un document exceptionnels que nous vous proposons de découvrir.
Par Katy Hazan, historienne, directrice du service Archives et Histoire de l'OSE, autrice de Rire le jour, pleurer la nuit, les enfants juifs cachés dans la Creuse pendant la guerre (1939-1944) (Calmann-Lévy, 2014), qui contient notamment la transcription intégrale de Chabannes.
Dans l'auditorium Edmond J. Safra